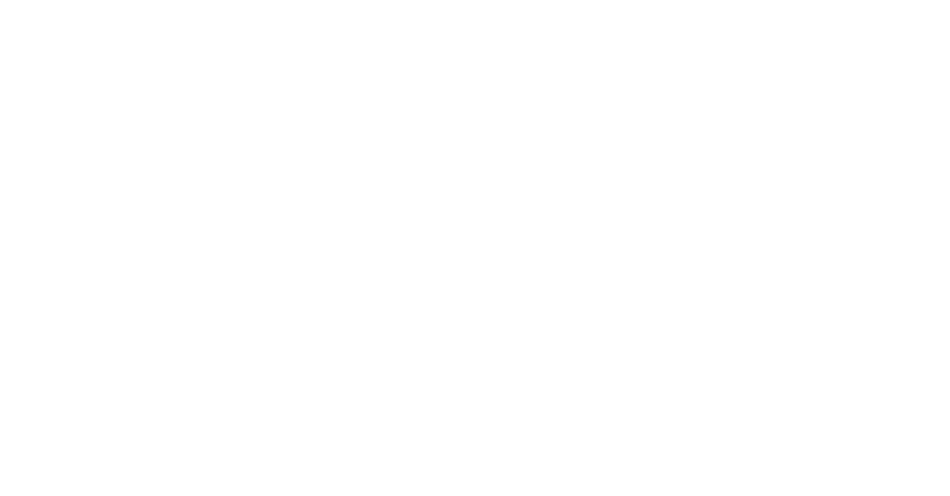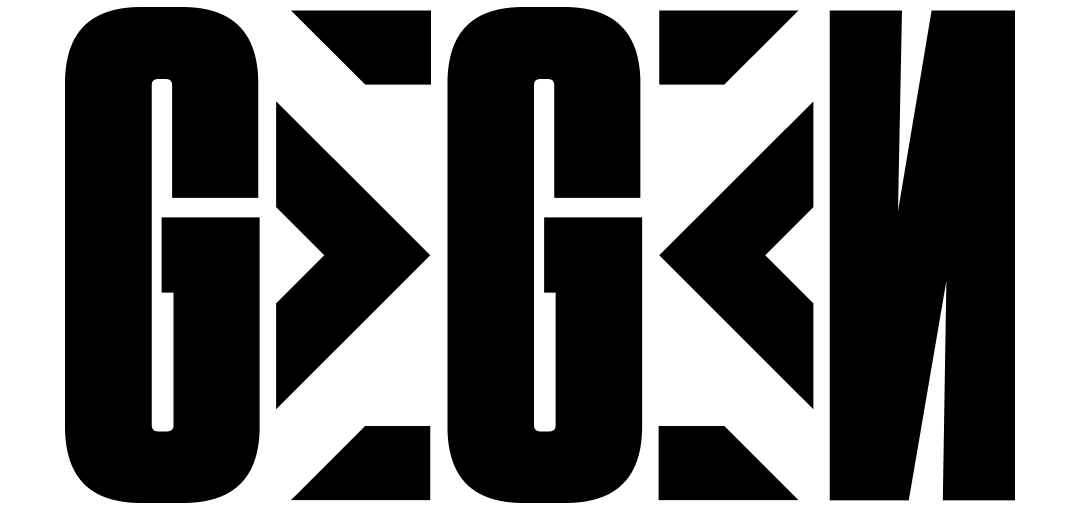Berliner Clubs: Es geht um mehr als nur das nackte Überleben
Beim Tag der Clubkultur öffneten 40 Clubs und Kollektive ihre Türen, um mit Tanzveranstaltungen, Konzerten und Diskussionen daran zu erinnern, dass sie weiterhin zur Kultur der Stadt gehören. Fokus der Veranstaltungen lag auch auf den Themen Vielfalt und Diversität.
3.10.2020 - 21:27, Antonia Groß
Beim Tag der Clubkultur öffneten 40 Clubs und Kollektive ihre Türen, um mit Tanzveranstaltungen, Konzerten und Diskussionen daran zu erinnern, dass sie weiterhin zur Kultur der Stadt gehören. Fokus der Veranstaltungen lag auch auf den Themen Vielfalt und Diversität.

Foto: Berliner Zeitung/Markus Wächter
Berlin - Es ist ein Beitrag zur Unterstützung ihrer Lieblingsclubs, den Fabio und Daniel gerne zahlen. „Zumal er uns das Wochenende versüßt. Das ist eine Win-win-Situation“, findet Daniel. Für das Ticket für einen zweistündigen Slot in den Kellerräumen des Kit-Kat-Klub in der Heinrich-Heine-Straße hat das Paar 18 Euro bezahlt. Der für seine Fetisch-Partys berüchtigte Laden ist für sie „ein Ort der Freiheit, der Lust und der Begegnung“, sagt Daniel. Hier können – oder konnten – sie Dinge erleben, „die im Alltag nicht möglich sind“.
In den Ecken stehen Zahnarztstühle, an der Decke schweben nackte Schaufensterpuppen, an den Steinwänden hängen schwarz-weiße Fotos des Künstlers Gili Shani, Dokumente vergangener Partys der Kit-Kat-eigenen Reihe „Gegen“. Aus Zeiten, in denen Freizügigkeit, Lack und Leder den Takt der Nächte bestimmten – ganz analog. Heute lassen Schwarzlichtröhren die auf dem Boden aufgeklebten Pfeile aufleuchten, die die Gehrichtung vorgeben. Da und dort steht Desinfektionsmittel bereit, Aushänge erinnern an die Maskenpflicht. Fast beiläufig spaziert derweil die Performerin Miss Aneris durch die Gänge, an ein Halsband gekettet führt sie eine Person bei sich, auf allen Vieren. Selbst wenn die überwiegend schwarzen Masken an diesem Ort nicht sonderlich auffallen – das Kit-Kat-Publikum steht auf extravagante Outfits – infrage gestellt wird die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, bei den Gästen des heutigen Tages nicht. Im Gegenteil: sie sei „alternativlos“, kommentiert Daniel.
Dass das Kit Kat an diesem Sonnabend seine Türen geöffnet hat, ist Ausnahme und Teil des „Tags der Clubkultur“. Damit ist es einer von 40 Clubs, die ein fünfköpfiges Kuratorium auf Initiative der Clubcommission und der Senatsverwaltung für Kultur und Europa für ihr „Engagement in der Berliner Clubkultur“ ausgewählt hat. Vom Hofkonzert über Outdoor-Tanzveranstaltungen bis zu Performances, Diskussionsrunden und Lesungen haben kleine Kollektive wie Betreiber etablierter Szenelokale ein vielfältiges Programm aufgefahren.

Foto: Berliner Zeitung/Markus Wächter
Als Auftakt diskutierten die Mitglieder des Kuratoriums mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke) auf der Terrasse des Hauses der Kulturen der Welt die Perspektiven der unter der Pandemie versickerten Infrastruktur des Nachtlebens. Denn anders als die Raver, die sich über den Sommer die Berliner Parks angeeignet haben, sind die Clubs seit März restlos geschlossen. Kompromiss-Angebote wie etwa Biergärten, die manch ein Betreiber auf den Außenflächen eingerichtet hat, konnten die ausbleibenden Einnahmen nicht annähernd decken. Ein Ziel für die Szene bleibt also weiterhin, die materielle Existenz zu sichern. Die Stadt müsse deshalb dafür sorgen, „das Delta zwischen Fixkosten und weggebrochenen Einnahmen“ zu schließen, und dafür weiterhin Hilfsprogramme aufzustellen, sagte Lederer. Dabei ginge es auch um „den Kampf um jeden einzelnen Club“.
Doch neben Fragen nach dem nackten Überleben, so waren sich Kuratorium und Senator einig, gelte es, langfristig zu denken. Es sind altbekannte Herausforderungen, die in der Krise für die Kulturszene nur drängender wurden: so wie die „Anerkennungskämpfe der Clubs als kulturelle Orte“ und natürlich das Thema Verdrängung durch Nachverdichtung – die schleichende Wanderung jener „Freiräume, die auch bisschen was anarchisches“ haben, in Richtung Randbezirke, sagte Lederer.
Besonderer Fokus der Kuratorinnen und Kuratoren in der Auswahl der 40 Veranstaltungsorte waren die Themen Awareness und Diversität: also die Beteiligung marginalisierter Gruppen in den Konzepten und Programmen für den Tag und darüber hinaus. In Bezug auf die Black-Lives-Matter-Proteste müsse man gerade jene Veranstalter und Kollektive fördern, die für marginalisierte Gruppen geschützte Räume anböten, sagte Kuratorin Lewamm „Lu“ Ghebremariam. Da dies ohnehin nicht die Orte, „die Kohle haben“ seien, gebe es andernfalls „nächstes Jahr ein böses Erwachen“, so Ghebremariam.

Foto: Berliner Zeitung/Markus Wächter
Neben den großen Namen wie SchwuZ, Cassiopeia, Gretchen und dem SO36 waren am Sonnabend auch Kollektive wie der Zigrahof aus Neukölln mit von der Partie. Im Innenhof des re:publica-Campus in der Zigrastraße spielten den Nachmittag über rund zehn verschiedene Bands – ein großer Teil der Musikerinnen und Musiker proben in den Räumen im alten Gewerbegelände nebenan. An Biertischen und auf dem Boden des weitläufigen Innenhofs tummelte sich die Kieznachbarschaft, zufällig Gestrandete und die „Neuköllner Musikszene“, wie Mitveranstalterin Christina Badde erzählte.
40 Partys trotz steigender Infektionszahlen und neuer Debatten um Feier-Obergrenzen? Die Veranstalter am Sonnabend schienen sich ihres Rufes und ihrer Verantwortung bewusst zu sein. Die meisten Tickets mussten vorab bestellt werden, die Teilnehmer wurden registriert und die Teilnehmerzahlen gedeckelt. Die sichtbare Solidarität der Szene jedenfalls – ob bei einem Ausflug in die Light-Version der Kit-Kat-Unterwelt oder in die warme Herbstsonne beim Hofkonzert – machte es für einen Moment leicht, den Worten von Kuratoriums-Mitglied und DJ Markus Lindner zu glauben, „dass sich Subkultur immer einen Weg sucht“.
© Berliner Zeitung | berliner-zeitung.de