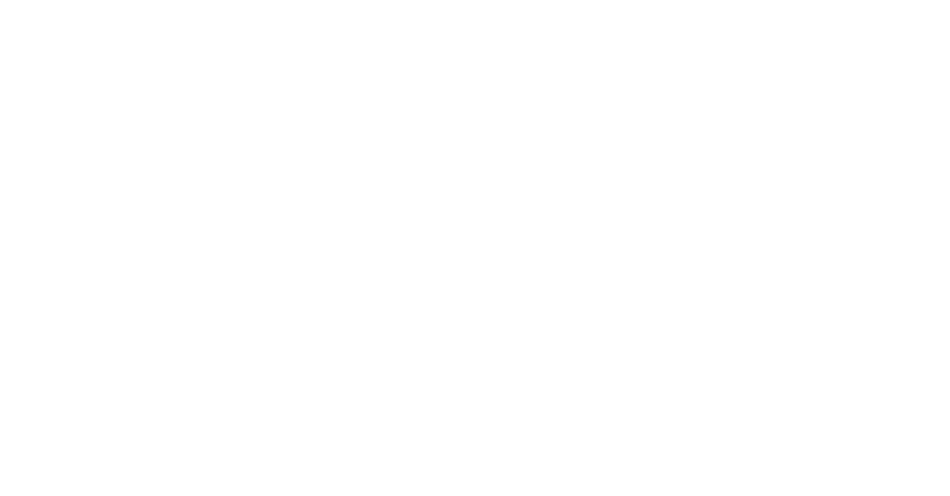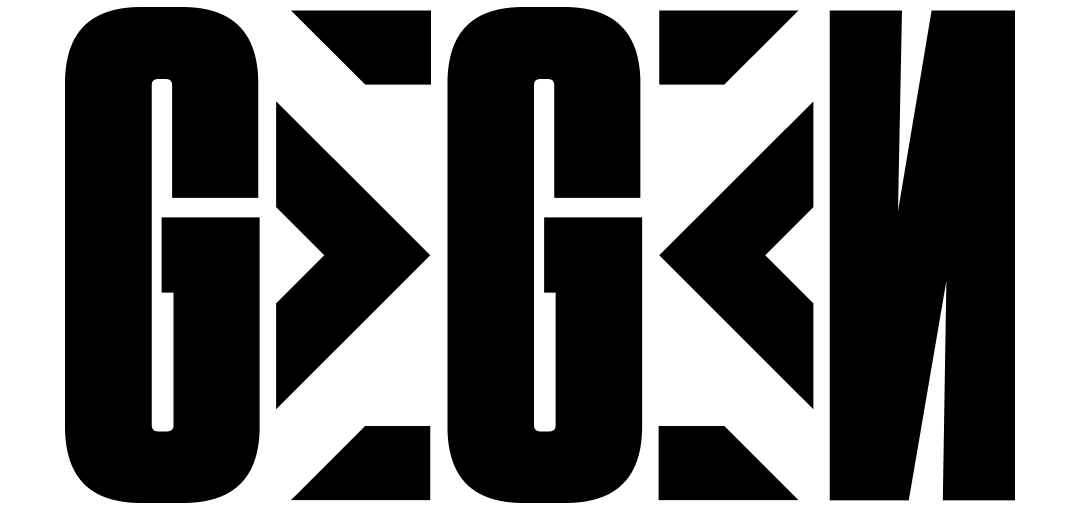Er wird von der FOCUS-Online-Redaktion nicht geprüft oder bearbeitet.
Sexpositive Partys
So exzessiv sind Nächte im legendären "Kit Kat"-Club
Señor SalmeNirgendwo auf der Welt wird so wild gefeiert wie in Berlin. Ein GQ-Autor war mittendrin und berichtet von einer wilden Nacht in der Hauptstadt
Samstag, 30.03.2019, 12:04
Nirgendwo auf der Welt wird so wild gefeiert wie in Berlin. Doch die beste Party von allen treibt den Exzess auf die Spitze. Ein GQ-Autor war mittendrin - und berichtet von einer wilden Nacht in der Hauptstadt.
Ein Hinterhof zwischen Mitte und Kreuzberg. Es ist gerade mal kurz nach 23 Uhr, für Berliner Verhältnisse also kurz nach dem Frühstück. Für uns aber ist der Tag vorbei. Wir sind mal wieder die Ersten, die anderen Nachtschichtler lassen allerdings nicht lange auf sich warten. Langsam füllt sich der Hof, halbnackte Körper vor Backsteinwänden. Niemand redet, die Stimmung ist konzentriert und aufgeregt, wie bei einem Fußballteam in der Kabine vorm Champions-League-Finale. Nur dass unsere Mannschaft keine Trikots trägt, sondern Korsagen, Ledergeschirr, Diverses aus Latex, Gürtel, Chokers mit Ringen oder Metallspitzen. Man sieht Hosenträger, Netzstrumpfhosen, Bodys, BHs, Masken, Badeanzüge, Bikinis, Nippelklebeband und Nippel ohne Klebeband.
Ich nehme mir einen Bügel aus einem der herumstehenden Wäschekörbe. Jetzt runter mit den Klamotten – und schön das Handy abgeben. Keine Beweise. Keine Verbindung zur Außenwelt. Bargeld, Zigaretten, Kaugummis, Kondome werden in die Socken (scheinbar trägt hier jeder weiße Tennissocken) gesteckt. Oder in die quer über die Brust geschnallten Gürteltaschen. Ein bisschen Nervosität liegt in der Luft, dabei haben wir alle schon das Schwierigste geschafft. Wir sind drin. Wir haben 15 Euro getauscht gegen ein unbezahlbares Abenteuer. Wir sind auf der besten Party der Stadt, auf der „Gegen“ im „Kit Kat Club“.
Die beste Party der Stadt im "Kit Kat Club"
Das „Kit Kat“ ist schon seit 24 Jahren eine Ikone des Nachtlebens, auf der ganzen Welt bekannt. Neben dem „Tresor“ (der heute direkt um die Ecke ist) ist der Club einer der allerletzten Überlebenden der mittlerweile mythischen Berliner Nachwendejahre. Noch heute ist das „Kitty“ einer der hottesten Spots in der Feierhauptstadt der Welt. Die Partyjünger von Tel Aviv, Sydney, South Beach und Brooklyn – sie alle beten gen Berlin. Die Jetsetter und Easyjetsetter haben hier vor allem zwei Ziele. Klar, das „Berghain“, seit 2004 die heilige Kathedrale für den Sonntagmorgen. Und das „Kit Kat“, eher eine Art sündiger Zirkus. Während der Club in den meisten Nächten wahlweise den gut bürgerlichen Swingerpärchen oder den harten Latexboys gehört, ist die „Gegen“-Party alle zwei Monate der: tja, Gegenentwurf zu allem, was in eine Schublade passt.

GQ Unterhaltung
| Getty Images
Der Plan für heute Nacht lautet also wieder: ankommen, abgehen, da steil gehen, geil dastehen, tanzen, als Teil des Ganzen. Die Vorfreude kribbelt, als ich der Garderobendame den Bügel mit meiner Jacke und meinem T-Shirt gebe. Sie trägt einen Fischnetzbody, der so ziemlich gar keine Funktion erfüllt. Sie merkt, dass ich ihr Outfit bewundere. „Drei Euro im Asiamarkt, in Lichtenberg oder wat dit is“, sagt sie. „Handy rinjesteckt?“ Ich nicke.
Wir betreten den Club. Wir sind: Unternehmensberater, Studenten, Banker, Journalisten, Touristen, In-Berlin-Gestrandete, Musik-Industrielle, Models, Lehrer – und vor allem sind wir hier nichts davon. Wir betreten den Dreh und Angelpunkt des Clubs, einen Raum, in dem von einer kreisförmigen, kontaktfreundlichen Couchlandschaft in der Mitte alle möglichen Wege in den Wahnsinn führen. Der erste Drink geht immer aufs Haus. Hallööööchen! Eine Dragqueen hält uns ein Tablett mit obskuren Wodka-Shots hin. Wir gehen an die Bar. Der zweite Drink ist immer eine Club Mate. Oder eine Cola. Oder ein Wasser. Und dann einen Shot Jägermeister hinterher, aber mehr nicht. Bloß nicht zu schnell durchglühen. Die Dinge werden hier von allein irre.
Es gibt nicht wirklich einen Dresscode. Höchstens einen Undress Code. Aber auch der ist nicht zwingend. Es gibt nur eine Regel: Feiere deinen Körper. Okay, ich versuch’s. (Übrigens: Einfach nur in Unterwäsche zu kommen funktioniert hier nicht, sagt das „Kit Kat“ sogar schon auf seiner Website: „Wir sind kein Sexclub!“) Ich trage mein irgendwie doch ziemlich normales Tanz-Outfit, der Wochenendtourist in der All-Black-Uniform der Technoarmee: High Tops, Chinos, Basecap, nur ohne T-Shirt. Stattdessen trage ich schwarze Samt-Hosenträger. Und am Hals, jetzt wird’s schon wilder: ein Lederband mit O-Ring, das ich noch am Nachmittag im „Schwarzer Reiter“ bekommen habe, eine Art Hoflieferant der Berliner Kinky Szene. Ich hatte so was noch nie vorher an. Tatsächlich ist dieses Halsband das einzige sichtbare sexuell aufgeladene Fashion Piece, das ich besitze. Aber es hilft natürlich. Reinzukommen. In den Club, auch das. Und in den richtigen Vibe.
Wie kommt man nur in diesen Club?
Das ist ja immer die wichtigste Frage, wenn es um Berliner Clubs geht: „Wie komm ich da rein?“ Die Antwort hat nur zum Teil mit dem richtigen Outfit zu tun, selbst in diesem Sex-Techno-Fetisch-Tempel. Wobei: Kate Moss kam vor ein paar Jahren im ersten Anlauf nicht ins „Kit Kat“, sie hatte schlichtweg zu viele Klamotten an. (Sie lief dann mit ihrem Begleiter um die Ecke, zog ihr Oberteil aus und schnürte sich ihren Ledergürtel um die Brüste. Ihr Begleiter ließ Hose und Unterhose weg. Dann durften beide rein.) Aber sich fürs „Kit Kat“ einfach nur in einen Fetisch-Look zu quetschen ist auch keine Garantie. Man muss auch irgendetwas ausstrahlen, das den Türsteher in weniger als einer halben Sekunde überzeugt, dass man das Exzess-Level einer Berliner Nacht aushalten kann. Und im besten Fall: dass die Party genau DICH noch braucht. Wichtig: Völlig high, besoffen oder übernächtigt sollte man vor keinem Berliner Türsteher stehen. (Ich wurde bei meinem geplanten dritten „Kit Kat“-Besuch weggeschickt. Der Typ an der Tür sah mir eine Sekunde in die Augen und sagte: „Du gehst mal schön nach Hause und schläfst dich aus.“ Ich war beleidigt, aber heimlich auch ein bisschen beeindruckt: Ich war tatsächlich mehr als 40 Stunden wach gewesen.) Und dann gibt es noch die Fünf-Sterne-Variante: Kenne Leute, die Leute kennen, die dich mit reinnehmen. Wie Mick Jagger, der sich das queere Treiben Ende Juni, während des jüngsten Berliner Stones-Stopps, endlich mal anschauen wollte.
Wir kommen an einem Stand vorbei, an dem zwei Präventionsberater stehen, die aussehen, als würden sie gleich einpacken und mitfeiern. Es gibt Care-Pakete mit Kondomen. Röhrchen. Desinfektionstüchern. Wir laufen los und lassen uns fallen wie Alice im Wunderland. In den nächsten paar Stunden werden wir immer wieder im Kreis laufen, Treppen hoch und Treppen runter. Ein Labyrinth von Räumen, Dancefloors, Separées, Kellern, Foyers durchqueren; zum Luftholen tauchen wir immer wieder auf zur Pool Area – hier wird gechillt im Wortsinne, abgekühlt. Aber bitte immer wieder: tanzen. Am liebsten auf dem großen Dancefloor. Die Musik ist fantastisch, gut gelaunter 80er-Jahre-House. Muskelboys in superknappen Shorts tanzen an der Gogo-Stange. Glückliche, verschwitzte Gesichter beamen Blicke durch den Raum. Klatschnasse Körper kommen sich immer näher.
Trixis und meiner zum Beispiel. Sie ist Teil unserer „Kitty“-Gang, aber wir kennen uns nicht. Noch nicht. Sie grinst die ganze Zeit, und wir reden beim Tanzen irgendwas, und irgendwann müssen wir uns küssen. Dann muss ich erst mal aufs Klo. Was anders als im Rest Berlins ist: Hier kommst du nicht zu zweit, zu dritt oder siebt auf die Kabinen, darauf achten die Herren und Damen Aufpasser. Die Leute, die sich zu Multiplayer-Sex oder Gruppenmedikation in eine Kabine verziehen wollen, die müssen den kleineren Toilettenraum im Keller aufsuchen. Da herrscht unübersichtliches Gewusel. Allerdings klopft auch dort irgendwann ein „Kit Kat“-Mensch an, wenn die geheimen Aktivitäten zu lange dauern sollten.
Zumindest zum Sexhaben muss man sich hier ja auch gar nicht einschließen. Es gilt: Tu, was du nicht lassen kannst. Überall in den Katakomben gibt es dunkle Ecken, Bänke, Sofas, Matratzen. Auch Trixi und ich ziehen uns irgendwann in die Empore über der Tanzfläche zurück. Wir machen rum, aber so richtig viel geht dann leider gar nicht. Dann eben wieder tanzen und durchs Labyrinth ziehen. Hoch und runter. Ich betrachte zum ersten Mal sehr aufmerksam die Kunst an den Wänden. Keine Kunst mit großem K, wie etwa im Berghain, eher so Psycho-Fantasy-Pornomalerei, lauter Aliens und freakige Gestalten mit außergewöhnlich vielen und außergewöhnlich großen Gliedmaßen. Eine beliebte Berliner Kunstrichtung, ich nenne sie „Penetration Painting“. Es gibt auf jeden Fall viel zu gucken.
Sowieso einer der besten Gründe, in Berlin auszugehen: gucken. Besonders viel zu sehen gibt es im „Kit Kat“ immer in einem Durchgangszimmer, das mit allerlei Krankenhausmobiliar ausgestattet ist: Zwei Betten, auf denen immer Pärchen liegen, nicht immer geht es da hart zur Sache, manchmal wird auch nur gekuschelt und gechillt. Ein Frauenarztstuhl, der besonders bei den Lederboys für Doktorspiele sehr beliebt ist. Eine Untersuchungsliege, auf der sich gerade ein hyperandrogynes Mädchen von einem anderen den Hintern versohlen lässt. Die Domina bellt ihre Sklavin auf Englisch an und vermöbelt sie hart. Ich setze mich an den Rand der Liege: „Can I watch?“ Sieht professionell aus und ist es auch, wie sich herausstellt. Rachel, 26, Dominatrix aus New York City. Sie ist zum ersten Mal in Berlin. Sie sagt, dass es in New York nur hinter geschlossenen Türen so abgehen würde, dann aber richtig. Ich erzähle ihr von geheimen Berliner Sklavenauktionen, von denen mir eine Freundin berichtete. Rachel ist null beeindruckt. Dann setzt sich das Mädchen mit den kurzen Haaren und dem tiefblau geprügelten Hintern zu mir. Ich frage sie, ob es sehr wehtut. Sie sagt: „Ja, ist geil.“ Sie bedankt sich, dass ich vorm Zuschauen gefragt habe, zückt ihr Handy (diese Rebellin!) und fragt mich nach meiner Nummer. Am nächsten Tag wird sie mich zu einer Privatparty bei sich und ihrem Verlobten einladen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Sie macht ein Erinnerungsselfie von uns. Wir küssen uns, und dann ziehen wir beide unserer Wege durch den Irrgarten der Lüste.
Dresscode der Bargirls: unten ohne
Auf dem größten Dancefloor legt jetzt die Berliner Technoqueen Ellen Allien auf. Der Bass wummert uns durch die Seelen, wir sind zuckende Zuckerpuppen. Durstig. Brauche Wasser. Und jetzt müsste auch mal wieder ein Shot sein. Also ab an die Bar. Die Bargirls haben einen eigenen Dresscode: unten ohne. Für jemanden, der sich sowieso schon am laufenden Band in Bedienungen sekundenverliebt, war das beim ersten Mal wirklich ein Schock. Da stehen diese tollen Wesen hinterm Tresen und haben ein Top an oder einen BH, aber zwischen Bauchnabel und Sneakers sind sie komplett nackt. Man weiß natürlich erst mal nicht, wo man hinschauen soll. Bloß kein Creep sein jetzt, aber man beeilt sich auch nicht unbedingt mit dem Bestellen und Bezahlen. Später in der Nacht hatte man dann aber auch genügend nackte Haut und Genitalien gesehen, um den zarten und gleichzeitig toughen Wesen an der Bar nicht ständig zwischen die Beine zu lugen.
Bargirl-Pro-Tipp: Wenn du einen signature shot hast und sie dreimal eingeladen hast, den mit dir zu trinken, dann erinnert sie sich an dich. Dann musst du nur noch an die Bar kommen und lächeln. Zwei Finger. Sie lächelt. Zwei Jägermeister, alles klar. Das ging super mit Nastassia. Irrerweise konnte sie sich noch bei der übernächsten Party, vier Monate später, an mich erinnern. „Du bist doch der Münchner.“ Marry me, Nastassia. Heute sage ich Ähnliches, aber zu Lina, dem bis auf die Nikes tatsächlich komplett unbekleideten Barmädchen, das mir nach dem fünften Shot-Duell dann sagt: „Sorry, ich bin asexuell. Ich steh einfach nicht auf andere Menschen.“ Wow. Von allen Abfuhren meines Lebens die überraschendste.
Ich suche die anderen meiner Gang, auf einem der kleineren Dancefloors tanze ich allein noch mal 30 Minuten oder so zu sehr farbenfrohem Trip-Techno. Um mich herum Sixpackboys in Neonpants, ein sehr wohlbeleibter, sehr behaarter Herr im Total-Nude-Look, zwei knutschende lockige Mädchen. Und vor mir tanzt eine riesige Blondine, Model bestimmt, in einem durchsichtigen roten Regenmantel. Darunter nur dünne Lederriemchen. Wir sind alle okay. Wir sind alle schön. Unglaublicherweise auch ich. Ich schließe die Augen, die Musik wirft mich gegen die Wolken, von wo ich zurück auf die Erde springe. Der Himmel ist eine Hüpfburg. Ich muss mal wieder festen Boden finden. Ich laufe zurück, durch das Krankenhauszimmer, an der Ecke vorbei, wo ich vor ein paar Monaten zum allerersten Mal vor Zuschauern Sex hatte, mit Stella, einer 23-jährigen Kunststudentin aus Long Island.
Als ich meine Sachen von der Garderobe hole, ist es zehn. Die Fischnetzdame hat noch Schicht. Trixi und die „Kitty“-Gang sind irgendwo. Die Jüngeren werden den Rest des Wochenendes durchziehen. Ich mag meinen Exzess mit Anfang und Ende. Ich laufe zur Spree. Die Sonne scheint. Die Wellen tanzen.
Dieser Artikel wurde verfasst von Amon Meerbeck
Im Video: Wie weit darf Lust gehen? Hier ist auch für Domina Angelina die Grenze erreicht
FOCUS Online
Wie weit darf Lust gehen? Hier ist auch für Domina Angelina die Grenze erreicht
Wie weit darf Lust gehen? Hier ist auch für Domina Angelina die Grenze erreicht
*Der Beitrag "So exzessiv sind Nächte im legendären "Kit Kat"-Club" stammt von GQ. Kontakt zum Verantwortlichen hier. GQ
© gq-magazin | gq-magazin.de